Nach der Sommerpause geht hier die zweiwöchige Augenspiegel-Kolumne weiter. Auch dieses Mal werfen wir wieder einen Blick auf die Wissenschaft und darauf, wie die Wissenschaftskommunikation im Netz über die Forschung berichtet. Einen ähnlichen Kuratierungsansatz verfolgt auch Alexander Mäder mit einem neuen Format bei Bild der Wissenschaft, das seit vergangener Woche immer Freitagabends erscheint: Wissen fürs Wochenende. Neben „Freitags nach eins“ von WiD gibt es nun also schon drei solcher Initiativen (den Chancen Brief der Zeit könnte man als E-Mail-Newsletter auch zu dieser Gattung zählen) – sehr schön!
Es gibt aber auch viel zu berichten aus der Wissenschaft! Da hat sich nach meinem Urlaub einiges angesammelt. Zum Beispiel ganz viele Abschiedsgrüße an den nunmehr endgültig verstummten Kometen-Lander Philae. Am 30. September wird seine Muttersonde Rosetta sich zu ihm gesellen und auf dem Kometen 67/P krachen landen.
Videos der Woche
Blasen (im Sinne von Seifenblasen) sind kugelförmige Flüssigkeitsfilme, die Luft umschließen und in noch mehr Luft schweben. Aber was sind Anti-Blasen? Natürlich dünne Luftkugeln, die einen Flüssigkeitsball umschließen – in einem Gefäß dieser Flüssigkeit. Dianna Cowern vom Youtube-Kanal Physics Girl stellt diese Anti-Blasen und ihre erstaunlichen Eigenschaften vor.
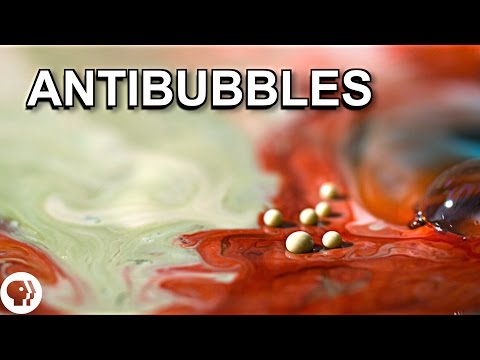
Video: Physics Girl
Die Wissenschaftssongs von Tim Blais in seinem Youtube-Kanal A capella science habe ich in den vergangenen zwei Jahren hier immer wieder vorgestellt. Das ist einfach eine sehr innovative und unterhaltsame Form der Wissenschaftskommunikation. Nach einem erfolgreichen Crowdfunding hat Tim Blais seine Videoproduktionen immer aufwändiger gestaltet. Nun hat er neun andere englischsprachige Wissenschaftsyoutuber zu einem musikalischen Projekt zusammengebracht. Ein beeindruckende Kollaboration und ein witziges Musikvideo über den Mathematiker und theoretischen Physiker William Hamilton (dessen Quaternionen-Schreibweise mich im Physik-Grundstudium einige schlaflose Nächte gekostet hat).
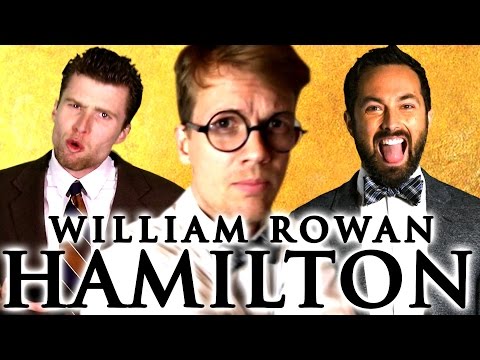
Video: A capella Science
Minute Physics erklärt in einem aktuellen Video Gravitationswellen.

Video: Minute Physics
Das Wissenschaftsmagazin Science erklärt in einer witzigen Animation, warum und vor allem wie Sonnenblumen dem Tagesverlauf der Sonne folgen.

Video: Science Magazine
Ein beeindruckendes Naturschauspiel: So sehen Polarlichter über der Antarktis-Forschungsstation Neumayer III aus.

Video: AWI
Parodie: Die Geschichte der Uni-Imagefilme muss wohl neu geschrieben werden!

Video: Teaser Produktion
Ganz nüchtern kommt dagegen das folgende Video daher, das den Tunnel des im Aufbau befindlichen European XFEL (X-Ray Free Electron Laser) in Hamburg zeigt.

Video: European XFEL
Am KIT fand soweit mir bekannt das erste TEDx-Event an einem Helmholtz-Zentrum statt.

Video: TEDx
Debattencheck
Wissenschaft im Dialog (WiD) hat mit Debattencheck eine neue Initiative gestartet, die zum Thema Flucht und Migration informiert. Themen sind zum Beispiel: Was ist Integration? Experten aus der Wissenschaft geben Antworten. Oder auch: Haben Flüchtlinge viele Krankheiten, wie in Sozialen Netzwerken zu lesen ist? Debattencheck geht mit Fakten aus der Wissenschaft auch auf mögliche Fehlwahrnehmungen in der Gesellschaft ein. Und die KollegInnen von WiD probieren neben klassischen Artikeln auch bei jungen Leuten angesagte Medienelemente aus: Bei den so genannten Kartenstapeln handelt es sich um durchklickbare Galerien aus Infotext- und viralen Bild-Elementen, wie man es von Portalen wie Buzzfeed kennt. Ich finde dies einen sehr gelungen Versuch, bei einem gesellschaftlich relevanten Thema falsche Überzeugungen mit der Stimme der Wissenschaft zu entlarven. Auch wenn ich die KollegInnen nicht um die Rechterecherche bei den viralen Bildern und Animationen beneide – für so etwas wäre eine Fair Use-Regelung im deutschen Urheberrecht sehr hilfreich!
Eine andere Debatte hat der Spiegel am vergangenen Wochenende wiederbelebt: Smartphones – sind sie gut oder böse? Okay, diese plumpe Verkürzung ist wahrscheinlich unzulässig. Glücklicherweise dauerte es nach dieser doch sehr kulturpessimistischen Sichtweise nicht sehr lange, bis es hierzu einige kulturoptimistische Erwiderungen erschienen, zum Beispiel von Dirk von Gehlen (auch bei der SZ) und von Sascha Lobo. Ich fürchte nur, dass diese Perspektive es nicht auf den Titel des Print-Spiegel schaffen wird.
Tweet der Woche
Zu Beginn meines Studiums Ende der 1990er Jahre war es bei uns noch verpöhnt, Internet-Quellen in wissenschaftlichen Arbeiten zu zitieren. Das wandelte sich dann Anfang der 2000er Jahre dahin gehend, dass man neben dem Datum des Abrufs auch die vollständige URL zitieren sollte. Nun sah ich erstmal einen spannenden neuen Umgang mit dieser Konvention nach dem Motto „Google es doch selbst!“.
danke @stalfel für das brechen mit dieser konvention. pic.twitter.com/tygBSpgdAp
— Kathrin Ganz (@ihdl) August 6, 2016
Wie sollen ForscherInnen kommunizieren?
Laut einer Umfrage unter 270 WissenschaftlerInnen gehört die Wissenschaftskommunikation zu den sieben zentralen Herausforderungen für die Forschung. Aber wie sollen sie kommunizieren? Der Guardian stellte zur Frage „unterhaltsam oder lieber ernsthaft“ zwei Positionen zur Diskussion, einerseits: Ich bin ein ernsthafter Forscher, kein professioneller Instagramer. Dean Burnett hielt dagegen: Ich entschuldige mich nicht dafür, unterhaltsam zu sein.
Und was ist mit spielerischer Kommunikation? Sollte die Wissenschaftskommunikation auf dem PokémonGo-Trend aufspringen? Erste Ideen zum Betreiben von Bürgerwissenschaft während der Pokémon-Jagd und zur wissenschaftlichen Untersuchung derselben gibt es bereits.
Über ein interessantes Experiment berichte Sabine Hossenfelder. Die Frankfurter Theo-Physikerin bot physikalische Beratung über Skype für jedermann an – für 50 US-Dollar pro 20 Minuten. In ihrem lesenswerten Bericht beschreibt sie, dass sie dort vor allem Kontakt mit Leuten (allesamt Männer) hatte, die zwar selbst keine Physiker, aber überzeugt davon waren, einem grundlegenden Fehler dieser Disziplin auf der Spur zu sein. Den Umgang mit dieser „Ich haben Einstein widerlegt“-Gruppe kennt wohl jeder, der in der Wissenschaftskommunikation arbeitet. Sabine Hossenfelder kommt zu dem Schluss, dass Autoren und Illustratoren bei ihren Produkten immer klar machen sollten, wann ihre Beschreibungen der Wissenschaft Metaphern bzw. künstlerische Darstellungen sind. Auch wenn ich diese Forderung teile, so glaube ich nicht, dass sie die Ursache für das Aufkommen dieser „Einstein-Widerleger“ sind bzw. dass man so vermeiden kann, dass diese Gruppe anwächst.
Nach 22 Jahren verabschiedet @GFZ_Potsdam Pressesprecher Franz 0ssing in den Unruhestand. Alles Gute! #TeamFranz /hk pic.twitter.com/8b8FmWdEdd
— helmholtz_de (@helmholtz_de) July 14, 2016
Mein Kollege Franz 0ssing hat sich vor einigen Wochen in den (Un)ruhestand verabschiedet. Zu diesem Anlass hat er uns noch einigen Lesestoff mit auf den weiteren Weg gegeben. Die einzige Folie seines kurzen Vortrags während des Symposiums zeigt ein paar Arbeitshandschuhe.
Blog-Hausmeisterei
Gerade entstehen zwei neue Wissenschaftsblogs hier unter dem Dach der Helmholtz-Blogs. Im Falter-Blog des UFZ geht es um Schmetterlinge und das Bürgerwissenschaftsprojekt Tagfalter-Monitoring. Im We Care-Blog des DFKZ dreht sich alles um die Krebsforschung. Wir haben damit nun 15 Blogs hier im Blogportal (14 deutschsprachig, davon 9 auch 10 englischsprachig, sowie ein rein englisches Blogs).
Kurz verlinkt
US-Präsident Obama veröffentlicht kurz vor Ende seiner Amtszeit noch einen wissenschaftlichen Fachaufsatz. Wissenschaft ist nach dieser österreichischen, nicht-repräsentativen Umfrage mit 49% das meistgehörte Podcast-Thema. Das deutsche Science Media Center (SMC) in Köln und das Deutsches Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz (DFKI) in Kaiserslautern werden untersuchen, wie sich Big Data Minig für die Wissenschaftskommunikation einsetzen lässt.
Die Augenspiegel-Kolumne
Die Kolumne „Augenspiegel – Webfundstücke rund um die Wissenschaft“ erscheint etwa alle zwei Wochen freitags im Blogportal der Helmholtz-Gemeinschaft. Darin stellt Henning Krause, Social Media Manager in der Helmholtz-Geschäftsstelle, Internetfundstücke aus dem Web 1.0 und dem Web 2.0 vor, die zeigen, wie sich der gesellschaftliche Diskurs um Wissenschaft im Internet abspielt: neue Kommunikationsformen, neue Technologien und Kommunikationskulturen. Bei dieser Kuratierung spielen Blogs, Apps, Facebook, Youtube und Twitter eine Rolle – anderseits auch Internet-Meme, Shitstorms und virale Videos.